Bedrohte Meeresbewohner
Fünf Frauen für die Big Five des Ozeans
Südafrika ist die Heimat der Big Five der Savanne. Doch einige der wahren Giganten der Tierwelt leben jenseits vom Kap der Guten Hoffnung: die Grossen Fünf des Ozeans – Wale, Delfine, Haie, Robben und Pinguine. Fünf Frauen kämpfen für die Zukunft der bedrohten Meeresbewohner.
Ist das hier einfach nur Glückseligkeit oder schlicht grobe Fahrlässigkeit? Der Mensch als Robbe inmitten eines fröhlich Pirouetten drehenden Schwarms Südafrikanischer Seebären – oder eher als willkommener Frühstückshappen, als plumpe Beilage eines üppigen Buffets für die Weissen Haie am Kap?
Wenn man Hanli Prinsloo so durch die angeschlagene Taucherbrille beobachtet, wie sie meerjungfrauengleich durch den Kelpwald gleitet, umringt von einer Schar neugieriger Ozeansäuger, sind die Fernsehbilder von Haimonstern, die Seelöwenkadaver durch die Luft wirbeln, und Steven Spielbergs Blockbuster-Urgetüm urplötzlich vergessen. Der Seebärenbezirzte nimmt einen weiteren Luftzug durch den Schnorchel und versucht der Freitaucherin durch den wogenden Tang zu folgen. «Entdecke die Robbe in dir!», hatte Prinsloo beim Atemtraining dem Freitauch-Neuling mit auf den Weg gegeben. «Wir teilen als Mensch mit Seebären, Delfinen und Walen den Tauchreflex, die Fähigkeit, mit einem Atemzug in ungeahnte Tiefen vordringen zu können.» Sie hat gut reden: Die heute 45-Jährige hat bereits vor 20 Jahren ihren ersten südafrikanischen Rekord im Freitauchen aufgestellt. Etliche weitere folgten. Bis zu 60 Meter und bis zu sechs Minuten unter Wasser schafft die Südafrikanerin mit einem einzigen Atemzug. Heute bringt sie Touristen zu den schönsten Tauchspots am Kap und macht mit ihrer «I am Water»-Stiftung als engagierte Meeresschützerin benachteiligte Kinder von der Küste mit der bedrohten Tierwelt Südafrikas bekannt. «Nur wenn Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen Südafrikas die Möglichkeit haben, den Ozean kennenzulernen, werden sie sich auch für seinen Schutz einsetzen», sagt Prinsloo.
[IMG 2]
Wer der Freitaucherin in die Tiefe des Tangwalds am Kap folgt, begreift das Anliegen der Südafrikanerin unmittelbar. Wohl nirgendwo sonst kommt man Südafrikanischen Seebären näher als auf einem Schnorchelausflug mit Prinsloo in der Cosy Bay bei Kapstadt. Auf ein paar Felseninselchen zu Füssen der weltbekannten Twelve-Apostles-Bergkette fläzen sich Dutzende Robben dicht gedrängt nebeneinander. Menschliche Eindringlinge in ihr Revier lassen sie im Wasser überraschend eng an sich heran und zeigen kaum Furcht, wenn man direkt vor ihrem Badefelsen auftaucht. Dann glotzen sie die unbeholfenen Freitaucher-Neulinge nur mit erstauntem Welpenblick an. Für viele wird eine Begegnung mit den Seebären zur Initialzündung für den Schutz ihres Lebensraums.
[IMG 6]
Haie – Jäger oder Gejagte?
Wo aber sind die Weissen Haie? «Wir können es nicht abschliessend sagen», antwortet Alison Towner mit Blick auf das Meer bei Gansbaai, ungefähr zwei Autostunden östlich von Kapstadt. Eigentlich ist Gansbaai weithin bekannt als «Welthauptstadt der Weissen Haie». Zahlreiche Filmaufnahmen der berüchtigten Raubfische auf der Jagd nach Robben wurden hier vor der Küste gedreht. Mit bis zu fünf Metern werden sie bisweilen länger als ein Breitmaulnashorn und bringen manchmal auch genauso viele Kilo auf die Waage.
«Der Mensch ist verantwortlich für den starken Rückgang der meisten Haipopulationen.»
Alison Towner, Meeresbiologin
Touristen aus der ganzen Welt kommen für eine Begegnung mit ihnen zum Käfigtauchen nach Gansbaai. Doch das Auge-in-Auge mit den gefürchteten Jägern, das man hier zeitweise fast garantieren konnte, gehört nun erst einmal der Vergangenheit an. «Die ersten Kadaver von Weissen Haien fanden wir 2017 bei Gansbaai», erklärt die britische Meeresbiologin, «ihre Lebern waren herausgerissen.» Zwei zeigten deutliche Spuren, dass sie Opfer von Schwertwalen wurden. «Zur gleichen Zeit beobachteten wir zwei Orcas, die in Südafrika bereits seit einiger Zeit bekannt waren», erzählt die 38-jährige Forscherin. «Wir nennen sie Port und Starboard» – englisch für Back- und Steuerbord. Ihren Namen hatten sie durch ihre wie bei vielen in Delfinarien gehaltenen Tieren nach links und rechts abgesackten Finnen erhalten. Sie werden nicht nur für das Verschwinden der Weissen Haie um Gansbaai verantwortlich gemacht, sondern inzwischen auch fast entlang der gesamten Küste zwischen Kapstadt und Mossel Bay, wo sie über Jahrzehnte häufig und Ziel von Käfigtauchern waren. Towner geht davon aus, dass etliche dem bei Schwertwalen ungewöhnlichen Jagdverhalten auf Haie spezialisierten Duo Port und Starboard zum Opfer fielen. Andere flohen wahrscheinlich vor den Orcas Richtung Madagaskar und Mosambik. Ob und wann sie zurückkehren, scheint derzeit ungewiss. Gansbaai hat seine Hauptattraktion verloren. «Es gibt tatsächlich Leute, die allen Ernstes sagen: ‹Lasst uns die Orcas abknallen›», sagt Towner. Die Meeresbiologin, die sehr wohl um den Wert der Haie für den Tourismus weiss, sieht die Situation jedoch viel differenzierter. «Der Mensch ist verantwortlich für den starken Rückgang der meisten Haipopulationen», sagt Towner. Entscheidender für das Überleben der Haie sei es, sich über den Einfluss von Überfischung, das Einsetzen von Hainetzen und den Klimawandel Gedanken zu machen.
[IMG 7]
Wer in Gansbaai Haien im Käfig begegnen will, hat indessen weiter gute Chancen. «Den Platz der Weissen Haie für Touristen haben nun überraschend Bronzehaie eingenommen», sagt Towner. Vorerst also müssen sich Touristen bei Gansbaai mit einem nur etwa zwei Meter grossen Verwandten der Weissen Haie zufriedengeben. «Aber wer weiss schon, wie lange noch», sagt Towner. «Die Orcas können jederzeit zurück sein.» Auch Bronzehaie verschmähen sie nicht.
Delfine – Akrobaten der Meere
Von Gansbaai ist die Meeresbiologin Sandra Hörbst auf einem Walbeobachtungsboot zur vorgelagerten Dyer Island aufgebrochen. Die Insel ist für ihre grosse Seebärenkolonie bekannt. Wohl nirgends stehen die Chancen besser, die Big Five des Ozeans bei einem einzigen Meeresausflug zu sichten. Hörbst und ihre Kolleginnen erklären Touristen nicht nur die einzigartige Meeresfauna Südafrikas, sie machen sie auch auf ihre Bedrohung aufmerksam. Gleichzeitig sammeln sie Daten zu verschiedenen Arten. Hörbst forscht seit 2013 über Delfine und Wale in Südafrika. Die im Tannheimer Tal in Tirol aufgewachsene 32-Jährige kann heute ihren Gästen bereits kurz nach Verlassen des Hafens dieerste Sichtung eines Meeressäugers verkünden. In der Ferne schnellen die Rückenflossen von gleich mehreren Delfinen aus dem Meer. «Bleifarbene Delfine», freut sich Hörbst. Es ist nur eine von drei Delfinarten, die man hier beobachten kann, und die gefährdetste. «Wir haben nur noch etwa 500 von ihnen entlang der südafrikanischen Küste», sagt Hörbst, «zunehmende Entwicklung entlang der Küsten, Meeresverschmutzung und Fischernetze tragen noch immer zum Rückgang der Population bei.»
[IMG 3]
Wale – die wahren Riesen Südafrikas
Doch es gibt auch gute Nachrichten vom Kap. Als die erste Walfluke vor dem Ausflugsboot auftaucht, schwappt ein Jauchzen durch die Passagierreihen an der Reling. Die Touristen nähern sich bald einer Walmutter mit einem auffallend weissen Kalb. Das sich langsam nähernde Boot scheint die Meeressäuger nicht zu stören. Im Gegenteil: Die beiden schwimmen geradezu auf das Boot zu. Südliche Glattwale werden bis zu 18 Meter lang und maximal 80 Tonnen schwer, was dem Gewicht von mindestens acht Elefantenbullen entspricht. Einst standen sie am Rand der Ausrottung, doch ihre Zahl hat sich seit dem Verbot des kommerziellen Walfangs 1986 in Südafrika deutlich erholt. «Wir haben in diesem Jahr so viele Tiere wie selten gesehen und verzeichnen sogar Rekordzahlen», sagt Hörbst. 568 Walmütter mit Kälbern sowie 40 Einzeltiere wurden bei der letzten Zählung erfasst, die höchste Anzahl seit 1969. «Wir sind überaus glücklich, dass wir nun auf quasi jeder Bootstour in der Saison mehreren Walen begegnen», sagt Hörbst, «manchmal sind die Boote geradezu von den Tieren umzingelt.»
[IMG 4]
Pinguine – die letzten ihrer Art
Und um den kleinsten Vertreter der «Big Five desOzeans», den Brillenpinguin, machen sich jedoch nicht nur Meeresbiologen bereits seit Langem Sorgen. Im Pinguin- und Meeresvogel-Zentrum in Gansbaai watschelt vor strahlenden Kinderaugen eine Gruppe der possierlichen Tiere um ein kleines Schwimmbecken. Sie warten auf ihre Fütterung. «Wir haben in den letzten 100 Jahren ganze 99 Prozent der ursprünglichen Population verloren», sagt Pinkey Ngewu von der Naturschutzorganisation Dyer Island Conservation Trust. Für diesen dramatischen Rückgang der Bestandszahlen machen Wissenschaftler unter anderem die Verschlechterung des Nahrungsangebots durch Überfischung und die Meeresverschmutzung verantwortlich. «Wenn wir die Entwicklung nicht aufhalten können, könnte die Art bereits um 2030 ausgestorben sein.» Warum der Brillenpinguin zu den Big Five des Ozeans gezählt wird, erschliesst sich angesichts seiner Grösse von maximal 70 Zentimetern nicht wirklich. Riesengross sind auf jeden Fall die Sympathien, die ihm die Südafrikaner entgegenbringen. Es ist die einzige Pinguinart, die in Afrika heimisch ist.
[IMG 5]
2015 hat der Dyer Island Conservation Trust das Schutzzentrum in Gansbaai eröffnet. Die Tierärztin Liezl Pretorius kümmert sich hier um verletzte Pinguine und päppelt verwaiste Jungvögel auf, um sie auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. «Etliche Tiere verheddern sich in Fischernetzen oder verletzen sich an Abfällen, die ins Meer gelangen», sagt die 44-Jährige, «andere sind durch Krankheiten geschwächt.»
«Es gibt zwar viele Gründe, warum die Anzahl der Pinguine noch immerabnimmt», sagt Pretorius. «Für mich ist das fehlende Nahrungsangebot ein Hauptgrund. Wenn wir es nicht schaffen, dafür zu sorgen, dass die Tiere genauso viel Fisch zu fressen haben wie wir Menschen, wird ihr Überleben fraglich bleiben.»
Auch durch den Guano-Abbau raubte der Mensch den Tieren jahrzehntelang die Grundlage für ihre Nestgruben. Weil sie nun vielerorts ihre Eier auf einem ungeschützten Fels ablegen müssen, sind Jungtiere der Witterung und Nesträubern schutzlos ausgeliefert. Seit Jahren werden speziell für die Pinguine hergestellte, künstliche Nisthöhlen entlang der Küste aufgestellt. Den enormen Bestandsverlust konnte aber auch diese Massnahme bisher nicht wesentlich aufhalten. «Von ursprünglich mehr als einer Million Brutpaare sind heute weniger als 15 000 übrig», sagt Ngewu.
Die südafrikanische Regierung will zukünftig die Fischerei um sechs wichtige Brutgebiete der Brillenpinguine verbieten. «Für die verbleibende Population könnte das überlebensnotwendig sein», sagt Pinkey Ngewu, «es ist jedoch noch immer nicht in die Praxis umgesetzt.»
Das Schutzzentrum in Gansbaai soll nicht nur als Krankenstation für die Vögel dienen, sondern auch dazu, in- und ausländische Gäste auf die Bedrohung der Brillenpinguine aufmerksam zu machen. Ngewu glaubt an die Besucher als Botschafter für die Grossen und Kleinen der «Big Five des Ozeans». «Wir müssen mehr Menschen für den Schutz der Meere gewinnen», sagt sie. «Noch ist es für viele seiner Bewohner nicht zu spät.»













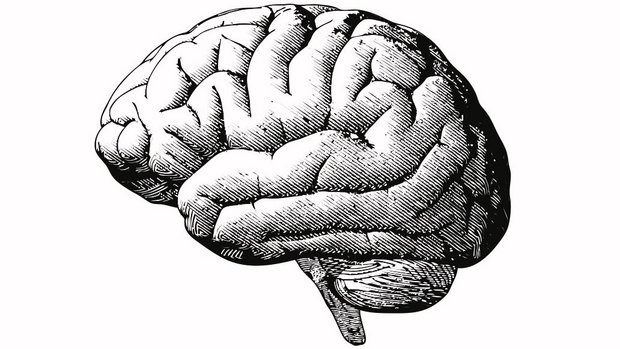





Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren