Irland Westküste
Blökende Reisebegleiter
Von Cork bis Derry erstreckt sich der «Wild Atlantic Way» der irischen Westküste entlang. Die Landschaft verändert sich ständig in Farbton und Struktur, doch die Schafe bleiben.
Ihr Ruf eilt der Grünen Insel voraus: «Überall Schafe!», ist der erste klischierte Gedanke, der mit Irland in Verbindung gebracht wird. Und tatsächlich sind in Irland überall Schafe zu sehen, jedoch nicht nur in Herden zu Hunderten auf saftiggrünen Weiden, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Vielmehr sind sie einzeln oder in kleinen Grüppchen anzutreffen. Aber eben: überall.
Spätestens nach der Vollbremsung auf Achill Island ist mir klar, wie dieses «überall» zu deuten ist. Hinter einem kleinen Hügel taucht ein Mutterschaf mit seinem Lamm mitten auf der Strasse auf, offensichtlich nicht ahnend, dass es gegen einen Kleinbus keine Chance hat. Erst jetzt, wo der Wagen stillsteht, bewegen sich die Tiere und zotteln gemächlich auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. «Wenn es einen Unfall gibt, musst du zahlen», erklärt mir Martin Calvey, der Besitzer der Schafe auf der grössten Insel Irlands hinterher ruhig. Die nonchalante Gemütlichkeit der Schafe scheint sich auf ihn übertragen zu haben. «Dafür gehört dir das Fleisch», ergänzt er. Calvey hält und schlachtet seine Tiere seit über 50 Jahren. Ohne Zäune, ohne Mauern, die Tiere können auf der Insel frei herumspazieren. Rund 10 000 Stück auf 10 000 Hektaren Land. So wundert es nicht, verteilen sich die Tiere weit herum und grasen auf dem kleinen Golfplatz ebenso wie im «Wohnzimmer» einer jahrtausendealten Dorfruine.
Anstatt die Schafe einzuzäunen, sprayt ihnen Calvey einfach einen roten Fleck auf den Rücken, so kann er sie von den Tieren der anderen Schafhalter unterscheiden, wenn sie reif für die Schlachtbank oder die alljährliche Paarung sind. Und am Strassenrand weisen Schilder darauf hin, dass die Schafe immer Vortritt haben. Für Blechschaden und tote Schafe kommt der Fahrer auf.
Die Landschaft an Irlands Westküste verändert sich. Während die Wiesen in der Moorlandschaft Connemara in fast kitschigem Grünton übergangslos mit dem Atlantik verschmelzen, ragen weiter nördlich imposante Klippen aus dem Meer. Das Grün verblasst in Donegal allmählich zu einem unfruchtbaren Braun, gesprenkelt durch die Farbtupfer gelber Ginsterbüsche. Doch die Schafe warten auch hier schon auf mich. Die Wolle etwas länger, zerzaust von der steifen Atlantikbrise, gegerbt vom rau-nassen Klima, fühlen sich meine blökenden Reisebegleiter auch hier pudelwohl.
| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="5c0f5613-a05b-4b4b-b256-1aeaf020d998" data-langcode="de"></drupal-entity> |
Es gibt mehr als nur Dublin
Überhaupt scheint es keinen besseren Markenbotschafter für den «Wild Atlantic Way» zu geben als das inoffizielle Nationaltier Irlands. Dabei gäbe es noch weitere Kandidaten: Entlang der Küstenstrasse zwischen Cork im Südwesten der Insel und Derry, das bereits in Nordirland liegt, bietet sich die Natur förmlich zum Entdecken an. Auf Bootstouren können Delfine und gar Wale beobachtet werden. Hoch zu Pferd sind Ausritte auf dem Sandstrand möglich, Nationalparks bewahren die Fauna und Flora der Torfmoore (siehe Zweittext) und die prunkvollen Schlossgärten im Norden haben mit ihrer Abgeschiedenheit und «wunderschönen Langeweile» schon etliche Dichter und Maler inspiriert.
Der «Wild Atlantic Way» ist das neueste Projekt, Touristen aus dem Schmelztiegel Dublin in den Westen des Landes zu locken, weg von Guinnessbrauerei und Whiskey-Degustation, hin zur Natur. Seit diesem Jahr sind die Strassen entlang der Atlantikküste miteinander durch ein gemeinsames Logo verbunden. Wie ein 2500 Kilometer langer Leitfaden schlängelt sich der Weg von Norden nach Süden oder umgekehrt und lädt zu den verschiedenen Attraktionen ein, die Irlands wilder Westen zu bieten hat.
«Es regnet im Westen fünfmal mehr als in Dublin», erzählt mir eine Frau kurz vor meiner Abreise. Na und?! Kein Grund für mich, das nächste Mal in der irischen Hauptstadt zu bleiben. Die Schafe warten schliesslich auf mich. Überall.
Diese Reportage wurde ermöglicht von «Ireland Tourism».
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="9fec0c36-6274-4381-96b7-af7981ece303" data-langcode="de"></drupal-entity>
Das Torf-Problem
Auch heute noch wird in den ländlichen Gebieten Irlands mit Torf geheizt. Dies schadet den tierischen Bewohnern der Moore.
Ich sitze in einem Pub, eine kleine Band spielt mit Banjo, Gitarre und Geige den «Wild Rover», während ein offenes Torffeuer in einer Ecke lodert und den Raum mit einer behaglich warmen und duftenden Atmosphäre erfüllt. Die typisch irische Gemütlichkeit hat jedoch einen Haken. Vor Jahrtausenden schon wurden im Westen Irlands Abermillionen von Bäumen gefällt. Als Brennmaterial, aber auch, um Platz für Vieh, Felder und Häuser zu schaffen. Die entstandenen kahlen Flächen riss die Natur im Laufe der Zeit wieder an sich. Das nasse Atlantikklima sorgte dafür, dass die einstigen Wälder feuchten Mooren wichen.
Moorlandschaften bedecken heute einen grossen Teil Irlands. Schnepfen, Feldlerchen und Turmfalken fühlen sich hier ebenso wohl wie Hasen, Füchse oder Frösche. Doch ihr Lebensraum schwindet. Weil die fleissigen Iren immer weniger Bäume hatten, brauchten sie eine Alternative, um ihre Feuerstellen zu nähren. In den Mooren hat sich über die Jahrtausende abgestorbenes Pflanzenmaterial zu einem Sediment abgelagert, das mit speziellen Spaten aus dem Boden gestochen wird und – getrocknet – als Brennstoff verwendet werden kann.
Bis heute ist dieses für Irland typische Torffeuer in vielen Pubs und Wohnungen zu finden. Den Preis dafür bezahlt die Natur. Wo Torf abgebaut werden soll, wird zunächst der Boden entwässert. Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen verändert sich, sie müssen sich ein neues Habitat suchen. Mittlerweile sind etliche Vögel und Säugetiere in Irland gefährdet, weil ihnen der Platz ausgeht.
In der Schweiz schon lange verboten
Auf diese Bedrohung hat die Europäische Union reagiert: Mit der «Flora-Fauna-Habitat»-Richtlinie wurde der Abbau von Torf in einer Vielzahl neu geschaffener Naturschutzgebiete verboten. Sehr zum Ärger der Torfstecher, die sich bis heute hartnäckig gegen die neuen Regelungen wehren.
In der Schweiz ist der Abbau von Torf schon seit 1987 verboten. Doch auch wenn hierzulande vermutlich niemand damit seine Wohnung heizt, wird jedes Jahr tonnenweise Torf importiert. Hauptsächlich als Zusatz für Gartenerde. Da torfhaltige Erde jedoch den Boden versauert und sehr nährstoffarm ist, geht ihr Gebrauch allmählich zurück. Ersatz wird aus Holzabfällen hergestellt, die alle Vorteile des Torfs beinhalten, aber weder den Boden sauer machen noch die Vögel aus den irischen Mooren vertreiben.
Anreise Von Zürich und Genf verkehren täglich Flüge nach Dublin, von Basel dreimal pro Woche. Mietautos können direkt am Flughafen bezogen werden. Zwar verkehren Busse und Züge auf der ganzen Insel, flexibler ist man aber mit dem Auto. Die Fahrt quer durch die Insel nach Galway dauert etwa zweieinhalb Stunden (Achtung Linksverkehr!). Von dort aus kann die Reise entlang der Küste nord- oder südwärts in Angriff genommen werden. |
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

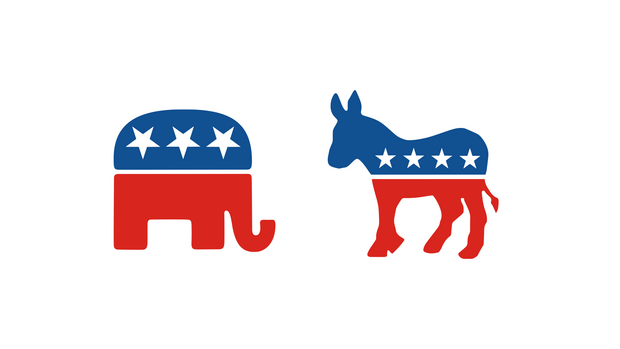












Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren