Futtermittel der Zukunft?
Wasserlinsen: Selber züchten für die eigenen Nutztiere
Mit Überschüssen an Gülle effizient Futtermittel produzieren – Wasserlinsen haben grosses Potenzial, Unangenehmes mit sehr Nützlichem zu verbinden. Doch es gibt noch so einige Herausforderungen beim Anbau der bisher kaum erforschten heimischen Schwimmpflanzen.
Effiziente Proteinlieferanten sind gefragt wie nie zuvor. Sowohl beim Tierfutter als auch bei der menschlichen Ernährung zeigt die Trendkurve unaufhaltsam nach oben. Kein Wunder, ist die weltweite Anbaufläche des proteinreichen Sojas in den vergangenen Jahrzehnten geradezu explodiert. Doch es gibt noch andere Kulturpflanzen, welche das Potenzial hätten, dem globalen Hunger nach Protein entgegenzuwirken. Eine noch ziemlich unbekannte ist die Wasserlinse. In getrockneter oder fermentierter Form kann sie mit dem Proteingehalt von Soja mithalten. Ihr grosser Vorteil: Sie wächst extrem schnell. So kann die Biomasse von Wasserlinsen innerhalb von nur zwei bis drei Tagen auf das Doppelte anwachsen. Auf derselben Fläche lässt sich so gut fünf- bis zehnmal mehr Protein produzieren als mit Soja. Und für dieses effiziente Wachstum brauchen Wasserlinsen nicht mal einen Acker, sondern nur ein Becken voller Wasser und ein bisschen Gülle.
Das schreit förmlich nach einem Nebenerwerb für Bauernhöfe, die immer wieder mit Gülleüberschüssen zu kämpfen haben. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft könnten die so produzierten Wasserlinsen sogar als Kraftfutter im Futtertrog der hofeigenen Tiere landen. Doch das ist alles noch Zukunftsmusik. Denn auf dem Weg zu einer rentablen und sinnvollen Nutzung von Wasserlinsen gibt es noch so einige Hürden.
Probleme der Aquakultur
Timo Stadtlander ist ein Experte in Sachen Wasserlinsen. Der Biologe weiss besser als kaum ein anderer, welche Probleme bei ihrem Anbau entstehen können. Während der letzten zehn Jahre hat er am Forschungsinstitut für Biolandbau (FiBL) zahlreiche Untersuchungen gemacht. Rund 80 Prozent der Kulturen seien ihm dabei gut gelungen. «Eigentlich ist es trivial und super einfach», so Stadtlander. Wenn er aber von den Schädlingen erzählt, die er an seinen Testbecken entdeckt hat, verstreichen einige Minuten. Die meisten, wie zum Beispiel Blattläuse, seien einfach zu bekämpfen – doch nicht alle. «Die Larven von Wasserschmetterlingen sind die schlimmsten», erklärt der Wissenschaftler. «In zwei Wochen können diese eine gesamte Wasserlinsen-Population ratzekahl leerfressen.»
Da die gefrässigen Larven unter den Linsen sitzen, kommt man kaum an sie heran. Bisher halfen nur Netze, um adulte Wasserschmetterlinge fernzuhalten. Diese Netze können aber gleich die nächsten Probleme auf den Plan rufen. So zum Beispiel Mikroalgen, die das Wachstum der Wasserlinsen im Konkurrenzkampf um Nährstoffe und Licht hemmen.
Wer den Anbau von Wasserlinsen auf nicht kommerzieller Basis ausprobieren möchte, kann sich beim FiBL praktische Tipps abholen.
Kontakt: timo.stadtlander(at)fibl.org / florian.leiber(at)fibl.org
Noch schlimmer sind aber die Blaualgen. Von deren Befall können sich Wasserlinsen zwar wieder erholen, doch die Ernte ist so oder so für die Tonne. Denn manche Blaualgenarten können gesundheitsgefährdende Giftstoffe produzieren und freisetzen. Ob die Arten, die in Wasserlinsen-Becken wachsen, solche Toxine produzieren, ist noch nicht geklärt. Nicht ganz unwichtig, wenn man bedenkt, dass Wasserlinsen beim Wachstum so einige Stoffe aus dem Wasser aufnehmen. Ist das Wasser mit Schwermetallen oder Antibiotika verunreinigt, können die Linsen auch diese aufnehmen. Wer Wasserlinsen anbauen möchte, muss sich also nicht nur Gedanken über allfällige Verschmutzungen des Wassers machen, sondern auch über Rückstände in der Gülle.
Zwingend mehr Forschung nötig
Ein weiteres mögliches Problem von Wasserlinsen ist der Ausstoss von Lachgas, welches deutlich klimaschädlicher ist als Kohlenstoffdioxid. «Es ist nicht so viel dramatischer als zum Beispiel bei Reisfeldern», beschwichtigt Timo Stadtlander. Aber können Wasserlinsen so überhaupt nachhaltiger sein als Soja? «Stand jetzt, nein», stellt der Biologe klar. Ein direkter Vergleich sei aber auch nicht wirklich fair gegenüber den Linsen. «In den letzten 50 Jahren wurden viele Millionen Dollar in die Sojaforschung investiert.» Die Forschung von Wasserlinsen hingegen startete erst richtig vor 10 bis 15 Jahren. Viele offene Fragen gilt es noch durch Studien zu beantworten. Darunter auch, wie hoch der Wasserverbrauch bei dieser Art von Proteinproduktion ist. Gezielte Züchtungen könnten die Wasserlinsen in vielerlei Hinsicht noch effizienter machen. «Die Herausforderungen sind noch enorm, aber auch das Potenzial ist gross», hält Stadtlander fest. «Wasserlinsen jetzt aber schon zu hypen, da bin ich komplett dagegen.»
Viele Vorbehalte
Jenseits von ersten Studien gibt es noch kaum praktische Erfahrungen im Umgang mit Wasserlinsen. «Das Problem ist eben, dass die Wasserlinsen in der Schweiz nicht auf der Positivliste der zugelassenen Futtermittel sind», erklärt Stadtlander. Da sie auch nicht verboten sind, befinden sie sich aktuell in einem rechtlichen Graubereich. Derzeit laufe aber ein von der Leopold-Bachmann-Stiftung finanziertes Projekt, dessen Ziel es sei, Wasserlinsen per Ende 2026 als Futtermittel zuzulassen.
Auch für den menschlichen Verzehr sind Wasserlinsen bisher in den meisten Ländern nicht erlaubt. Gründe sind unter anderem Bedenken wegen der Schadstoffe, die Wasserlinsen in sich aufnehmen können. Doch auch wenn es irgendwann zu einer Zulassung für den Direktverzehr kommen würde, ist ein Ansturm auf die Wasserlinsen zweifelhaft. Denn die meisten Menschen reagieren mit Vorbehalten, wenn sie erfahren, dass die Linsen direkt in Gülle wachsen - auch wenn diese stark mit Wasser verdünnt wird.
Talente der WasserlinsenFachkreise sehen in Wasserlinsen Potenzial für mehrere Verwendungszwecke. Deshalb wird in den folgenden möglichen Einsatzbereichen weltweit intensiv geforscht:
Futtermittel
Mit einem Rohproteingehalt von bis zu 45 Prozent in der Trockensubstanz eignen sich Wasserlinsen hervorragend als Tierfutter. Am häufigsten wurden sie bisher bei verschiedenen Fischarten untersucht, aber auch bei Geflügel und Schweinen. Für Legehennen sind Wasserlinsen besonders interessant, da die enthaltenen Karotinoide die Färbung des Eidotters positiv beeinflussen können.
Lebensmittel
In Asien werden Wasserlinsen traditionellerweise in Teichen gesammelt, selten auch angebaut und in Suppen oder als Gemüsebeilage verwendet. Israelische Firmen nutzen Wasserlinsen bereits industriell, um innovative Lebensmittel herzustellen. Die Produkte reichen von getrockneten Wasserlinsen-Snacks bis hin zu Proteinpulvern, die in Smoothies oder glutenfreiem Gebäck verwendet werden können.
Bio-Kraftstoff
Aufgrund ihres rasanten Wachstums könnten Wasserlinsen künftig Mais oder Raps als Energiepflanzen für die Herstellung von Bioethanol ablösen. Ein Vorteil bei diesem Verwendungszweck wäre, dass die offenen Fragestellungen wegen der Biosicherheit kaum Gewicht hätten.
Säuberung verschmutzter Gewässer
Untersuchungen haben gezeigt, dass Wasserlinsen, die in verschmutztem Wasser wachsen, Schwermetalle und Phosphor entziehen können. Deshalb könnten die Pflanzen künftig für Sanierungen von Abwasser aus dem Bergbau, aber auch aus städtischen Gebieten, dienen.








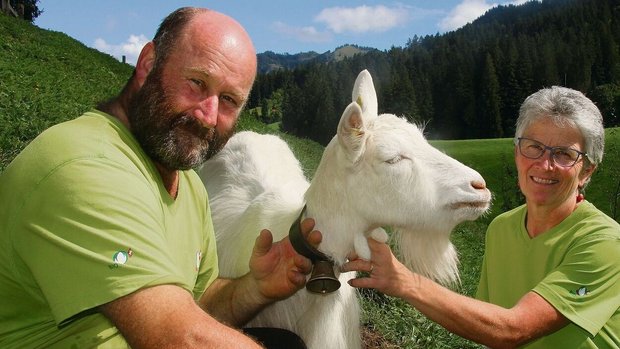

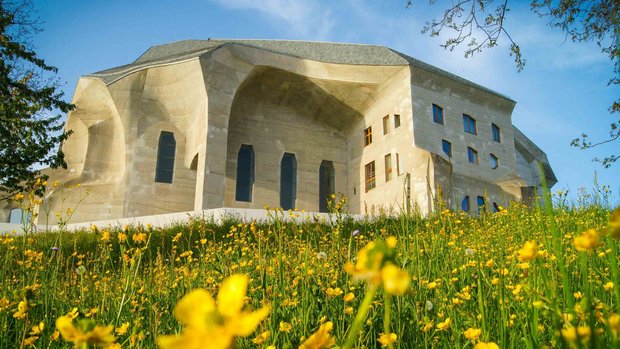




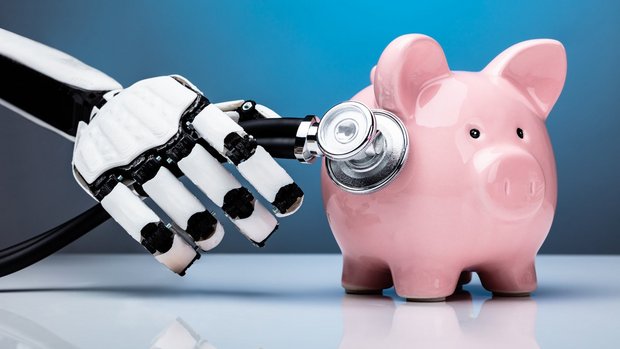

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren